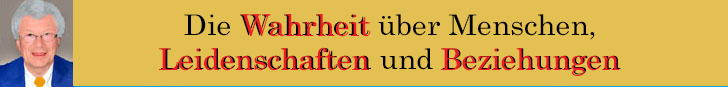Ziele erreichen: wenn die Wege widersprüchlich sind
Ziele erreichen: wenn die Wege widersprüchlich sind - am Beispiel von Ratschlägen für das Kennenlernen.
Wie erreiche ich ein Ziel? Wenn du „das Internet“ oder „die Experten“ fragst, dann wird dir oftmals das Blaue vom Himmel heruntergezogen. Und manches Mal wirst du feststellen, dass die Wege zum Ziel durchaus widersprüchlich sind.
Kann das sein? Und wenn ja, woher kommt das?
Nutzloser Rat ist kein guter Rat
Ja, es kann sein. Der Grund ist ganz einfach: Wer einen nutzlosen, allgemeinen Rat geben will, muss ihn einfach halten. Oder besser: So, dass er sofort verstanden wird. Es geht also nicht darum, jemanden wirklich zu beraten, sondern ihm oder ihr irgendeinen unverbindlichen Tipp zu geben.
Die zweite Grundlage von schlechtem, oberflächlichem Rat ist, dass dein Ziel mühelos zu erreichen ist. Dabei werden dann Fälle angeführt, die sozusagen „sofort“ zum Ziel geführt haben.
Probleme einfach zu lösen heißt nicht, sie mühelos zu lösen
Der Haken: Es gibt einige wenige Probleme, die sich „einfach“ lösen lassen. Einfach heißt aber nicht mühelos. Für solche Probleme gibt es mehrere Namen: Probleme zweiter Ordnung und Flaschenhals-Probleme.
Probleme zweiter Ordnung sind lösbar, aber nicht mit den Methoden, die du immer schon angewendet hast. Du bist einfach auf dem falschen Weg, der oft mit erheblichen Anstrengungen verbunden ist, aber nirgendwo hinführt. Das ist schwer einzusehen, weil du möglicherweise zu diesem Zeitpunkt schon deine Energien verpulvert haben. Und mehr Energie einzusetzen, bringt dich – wenn überhaupt – nur wenig voran.
Flaschenhälse sind Probleme, die auf einem Stau beruhen. Das Ziel scheint in greifbarer Nähe zu sein, aber „etwas“ behindert dich, es wirklich zu erreichen – das glaubst du jedenfalls. Als Lösung wird dir oft „mehr desselben“ angeboten, was zu noch mehr Stau und Frust führt. Das heißt, der Flaschenhals wird dadurch noch enger.
Die Lösungen kommen von DIR - woher sonst?
Das ist der „innere Kern“ aller Probleme: keine Lösungen mehr zu haben. Sich einreden zu lassen, es gäbe sie ja, die Lösungen. Dann fällt oft der Satz: „Du musst nur …“, und vielleicht glaubst du das ja wirklich. Es ist aber Blödsinn – jedes Problem benötigt eine individuelle Analyse, und du selbst bist aufgefordert, die Lösungen zu verwirklichen.
Der Kennenlern-Bereich als Beispiel
Du suchst jemanden, der schwer zu finden ist. Und du bemühst dich immer mehr, hast jedoch nie Erfolg. Unter den vielen Ratschlägen, die du bekommst, sind möglicherweise diese:
- Mach eine Pause und denke über dein Leben nach.
- Such dir eine andere Single-Börse (App, Agentur).
- Such nicht mehr online, sondern im echten Leben.
- Hör auf zu suchen, dann findest du.
- Verstärke deine Suche, indem du die mehr Zeit nimmst.
- Lege alle deine Energien in das Ziel.
- Reduziere deine Suche, indem du gezielter vorgehst.
Der einzig wirklich hilfreiche Rat unter all diesen Vorschlägen ist der erste – und zugleich derjenige, der am wenigsten befolgt wird. Alle anderen Ratgeber versuchen, dir neue Wege zu zeigen, die dir nichts nützen oder allenfalls kleine Veränderungen bringen.
Und nun fragst du natürlich: Ja, gibt es denn überhaupt Lösungen?
Lösungen finden heißt oft: Ziele genau zu beschreiben
Na klar. Doch die Hauptfrage ist: Welchen Lebensentwurf willst du mit deinem Partner (deine Partnerin) verwirklichen? Wenn dein Ziel ist „irgendwie einen Partner“ zu finden, dann bietest du niemandem einen Anreiz, dein Partner (deine Partnerin) zu werden. Wenn du aber einen „ganz besonderen Partner“ suchst, dann solltest du wenigsten wissen, wofür.
Womit nun klar sein dürfte, worauf es ankommt: Erstens darauf, dass du einen Lebensentwurf hast. Und zweitens darauf, dass du eine Person findest, die dieses Leben gut findet und es mit dir teilen will.
Wie fandest du diesen Artikel? Hast du Anmerkungen oder Kommentare dazu?
Wie erreiche ich ein Ziel? Wenn du „das Internet“ oder „die Experten“ fragst, dann wird dir oftmals das Blaue vom Himmel heruntergezogen. Und manches Mal wirst du feststellen, dass die Wege zum Ziel durchaus widersprüchlich sind.
Kann das sein? Und wenn ja, woher kommt das?
Nutzloser Rat ist kein guter Rat
Ja, es kann sein. Der Grund ist ganz einfach: Wer einen nutzlosen, allgemeinen Rat geben will, muss ihn einfach halten. Oder besser: So, dass er sofort verstanden wird. Es geht also nicht darum, jemanden wirklich zu beraten, sondern ihm oder ihr irgendeinen unverbindlichen Tipp zu geben.
Die zweite Grundlage von schlechtem, oberflächlichem Rat ist, dass dein Ziel mühelos zu erreichen ist. Dabei werden dann Fälle angeführt, die sozusagen „sofort“ zum Ziel geführt haben.
Probleme einfach zu lösen heißt nicht, sie mühelos zu lösen
Der Haken: Es gibt einige wenige Probleme, die sich „einfach“ lösen lassen. Einfach heißt aber nicht mühelos. Für solche Probleme gibt es mehrere Namen: Probleme zweiter Ordnung und Flaschenhals-Probleme.
Probleme zweiter Ordnung sind lösbar, aber nicht mit den Methoden, die du immer schon angewendet hast. Du bist einfach auf dem falschen Weg, der oft mit erheblichen Anstrengungen verbunden ist, aber nirgendwo hinführt. Das ist schwer einzusehen, weil du möglicherweise zu diesem Zeitpunkt schon deine Energien verpulvert haben. Und mehr Energie einzusetzen, bringt dich – wenn überhaupt – nur wenig voran.
Flaschenhälse sind Probleme, die auf einem Stau beruhen. Das Ziel scheint in greifbarer Nähe zu sein, aber „etwas“ behindert dich, es wirklich zu erreichen – das glaubst du jedenfalls. Als Lösung wird dir oft „mehr desselben“ angeboten, was zu noch mehr Stau und Frust führt. Das heißt, der Flaschenhals wird dadurch noch enger.
Die Lösungen kommen von DIR - woher sonst?
Das ist der „innere Kern“ aller Probleme: keine Lösungen mehr zu haben. Sich einreden zu lassen, es gäbe sie ja, die Lösungen. Dann fällt oft der Satz: „Du musst nur …“, und vielleicht glaubst du das ja wirklich. Es ist aber Blödsinn – jedes Problem benötigt eine individuelle Analyse, und du selbst bist aufgefordert, die Lösungen zu verwirklichen.
Der Kennenlern-Bereich als Beispiel
Du suchst jemanden, der schwer zu finden ist. Und du bemühst dich immer mehr, hast jedoch nie Erfolg. Unter den vielen Ratschlägen, die du bekommst, sind möglicherweise diese:
- Mach eine Pause und denke über dein Leben nach.
- Such dir eine andere Single-Börse (App, Agentur).
- Such nicht mehr online, sondern im echten Leben.
- Hör auf zu suchen, dann findest du.
- Verstärke deine Suche, indem du die mehr Zeit nimmst.
- Lege alle deine Energien in das Ziel.
- Reduziere deine Suche, indem du gezielter vorgehst.
Der einzig wirklich hilfreiche Rat unter all diesen Vorschlägen ist der erste – und zugleich derjenige, der am wenigsten befolgt wird. Alle anderen Ratgeber versuchen, dir neue Wege zu zeigen, die dir nichts nützen oder allenfalls kleine Veränderungen bringen.
Und nun fragst du natürlich: Ja, gibt es denn überhaupt Lösungen?
Lösungen finden heißt oft: Ziele genau zu beschreiben
Na klar. Doch die Hauptfrage ist: Welchen Lebensentwurf willst du mit deinem Partner (deine Partnerin) verwirklichen? Wenn dein Ziel ist „irgendwie einen Partner“ zu finden, dann bietest du niemandem einen Anreiz, dein Partner (deine Partnerin) zu werden. Wenn du aber einen „ganz besonderen Partner“ suchst, dann solltest du wenigsten wissen, wofür.
Womit nun klar sein dürfte, worauf es ankommt: Erstens darauf, dass du einen Lebensentwurf hast. Und zweitens darauf, dass du eine Person findest, die dieses Leben gut findet und es mit dir teilen will.
Wie fandest du diesen Artikel? Hast du Anmerkungen oder Kommentare dazu?